Sebastian Meier lebt auf dem Michlbauerhof in Ursensollen im oberpfälzer Landkreis Amberg-Sulzbach. 120 Milchziegen, 15 Wagyu-Rinder und 100 Legehennen samt Gockel nennt der Landwirt sein Eigen. Als Instrumentenbaumeister betreibt er auf dem Hof auch eine kleine Blechinstrumentenwerkstatt. Und dann ist er noch Musikant. In diversen Formationen bei allen möglichen Gelegenheiten. Im Wirtshaus und auf der Kleinkunstbühne, von der Wiege bis zur Bahre – womit wir beim Thema wären. Wastl, wie ihn seine Freunde nennen, beschäftigt sich auch mit Trauermärschen. Sebastian Gröller hat mit ihm für die »zwiefach« darüber gesprochen.
Text: Sebastian Gröller; Fotos: privat
Sebastian Gröller: Servus Wastl, danke, dass du dir für dieses Gespräch Zeit genommen hast. Wie stehst du zur Trauermusik?
Sebastian Meier: Ich lebe in einer ländlich, bäuerlich geprägten Region und denke schon, dass die gesellschaftliche Anteilnahme bei Begräbnissen hier bei weitem größer und persönlicher ist als in großen Städten. Ich habe mich viel mit alten Handschriften aus Archiven und Nachlässen von Trauermärschen und Trauerliedern beschäftigt. Dabei fällt auf, dass es große Unterschiede gibt.
Wir haben in verschiedenen Formationen diese Trauermärsche angespielt und festgestellt: Es gibt Stücke, bei denen man das Gefühl hat, die Melodien schon im Ohr zu haben – fast wie eine Aneinanderreihung bekannter Fragmente. Aber wir haben auch wunderschöne alte Trauermärsche gespielt, in denen echte Überraschungen vorkommen, zum Beispiel ein Wechsel im Trio von Moll nach Dur oder ein plötzlicher Tempowechsel. Was offensichtlich spürbar ist, zumindest nach meiner Wahrnehmung, lösen Trauermärsche von klassisch geprägten Komponisten oder Auftragskompositionen andere Emotionen aus als Melodien, welche von Tanzmusikern niedergeschrieben wurden.
Trauermusik ist leider dem kulturellen Verfall preisgegeben. Es wäre wichtig, der Tradition und ihrer Wirkung wieder mehr Raum zu geben. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass Geistliche oder Trauerredner heute oft keinen wirklichen Bezug zu ihren Schäfchen haben – während regionale Musikanten diesen Bezug noch spürbar mitbringen.
Welche Erinnerungen und Erlebnisse hast du mit Trauermärschen oder Prozessionen?
Da habe ich sowohl positive als auch negative Erfahrungen. Viele Beerdigungen habe ich respektvoll und den Verstorbenen ehrend umrahmt miterlebt – das war oft sehr emotional und ergreifend. Da waren viele schöne Erlebnisse dabei. Bei einem Trauerzug von der Kirche zum Friedhof (kann auch mal länger dauern) macht es für mich schon einen sehr großen Unterschied, ob die Prozession von einer Blasmusikformation begleitet wird, oder ob schweigend zum Friedhof gezogen wird. Bei einem wirklich langsam gespielten Prozessionsmarsch bewegt sich die Trauergemeinde viel langsamer als ohne Musik. Die Musik wirkt auf die Menschen, die Trauernden fühlen sich mehr getragen als ohne Musik. Erfahrene Tanzmusiker verstehen es sehr gut, eine Zeremonie musikalisch zu umrahmen, die Tempi wollen gut gewählt sein, ähnlich einem Tanzabend.
»Wir haben auch wunderschöne alte Trauermärsche gespielt.«
Ich bin auch davon überzeugt, dass bestimmte Melodien besser mit einer Landschaft, einer Stimmung, oder mit der Eigenart der Menschen in bestimmten Regionen harmonieren als andere. Aber wenn bei einem Trauerzug oder beim Begräbnis auf dem Gottesacker eine stimmige Blasmusikformation die passenden Stücke im passenden Tempo spielt, viele Vereine mit Fahnen dabei sind, Salutschüsse die Anwesenden erschrecken, Kränze niedergelegt werden, Trauerreden gehalten werden, dann empfinde ich das schon sehr stimmig und emotional sehr berührend. Bei gesprochenem Wort sind die Anwesenden viel mehr auf das Verstehen konzentriert als bei der Musik. Aber einige schlechte Beispiele gab es auch, eher unpersönlich und zu schnell vorbei, fehlende Empathie oder schlecht vorbereitet.
Trauerkapellen gab es bei mir in der Region, aber nicht viele und die wenigen haben Landkreisübergreifend gespielt. Im Augenblick weiß ich aktuell keine größere Formation, welche noch Beerdigung umrahmt, wenn da nicht ein Verein dahinter steht, zum Beispiel, wenn ein Mitglied des Musikvereins verstirbt. Junge Musikanten gibt’s zwar auch, die fähig wären, diese Musik zu spielen, aber die müssen arbeiten und können nicht einfach mal schnell eine Beerdigung spielen während der Arbeitszeit, da die Beerdigung in den meisten Fällen ja auch nicht zwei Monate vorher geplant werden kann. Wenn, dann spielen solche Gschäftl hauptsächlich Rentler und Berufsmusiker, selten noch eine Kapelle mit den regionalen alten überlieferten Trauermärschen. Da müsste ein Ehrenamt eingerichtet werden, das die Musikanten für solche Anlässe beim Arbeitgeber freistellt.
Heutzutage werden meist die Prozessionsmärsche von großen Blasmusikverlagen gespielt, oder der Trauermarsch von Chopin oder einfache Choräle. Wenn überhaupt mal eine größere Formation auftritt und kein Solo-Musiker. Ich weiß es nicht, gibt’s noch Blaskapellen, die solch einen Service anbieten? Früher gab es Werkskapellen. Wie zum Beispiel die Bergknappenkapellen in Schlicht oder Amberg. Die haben in einer kleinen Besetzung die Beerdigungen ihrer Mitarbeiter gespielt. Heute buchen meist die Bestatter die Musiker. Die alte Tradition geht immer mehr verloren. Womit ich wenig anfangen kann, ist, wenn bei einer Beerdigung zum Bespiel My heart will go on von Celine Dion oder andere musikalischen Fehlgriffe aus der Konserve abgespielt werden.
»Stille ist meist eher beklemmend.«
Der Tod eines Menschen hat die Lebenden dazu bewogen, einen Ritus zu schaffen, um mit Tod, Trauer, dem Verlust des Menschen umzugehen, ihn zu verarbeiten. Welche Rolle spielt dabei die Tradition der Trauermärsche und welche Emotionen ruft diese Musik hervor?
Dazu möchte ich ein Beispiel geben: Wenn eine regional verwurzelte Kapelle auf einem Begräbnis spielt, dann kennt man sich mal mehr mal weniger persönlich. Das macht das Verabschieden des/der Verstorbenen für alle Beteiligten ein Stück leichter oder unterstützender. Die Musikanten spielen immer persönlich emotionaler, wenn Beziehungen zu den Anwesenden bestehen.
Für mich geht’s dabei nicht so sehr um Verarbeitung, sondern dass die Gemeinde da ist, um die Angehörigen des Verstorbenen in ihrer Trauer zu unterstützen. Die Besonderheit, die von der Musik ausgeht, ist, dass sie Raum gibt, Gedanken schweifen zu lassen. In keiner anderen Situation auf einer Beerdigung ist das gegeben. Die Blaskapelle spielt den Marsch, die Prozession, mit einem langsamen, getragenen Musikstück. Die Trauergemeinde hört zu und lässt die Gedanken einfach vorbeifliegen. Man erinnert sich an den Verstorbenen, erkennt aber auch die Erlösung oder sogar Fröhlichkeit in der traurigen Musik.
Wenn der Pfarrer, oder jemand anders spricht, dann hört man zu, die Gedanken gehen dabei bestimmt auch hin und her, aber das ist eine ganz andere Stimmung, als wenn man mit einer Klangwolke aus getragener Blech- bzw. Blasmusik umhüllt ist. Die Musiker kennen meist den Verstorbenen auch besser, somit kommt durch ihre Erinnerung und Bindung an den Toten Emotion in die Musik. Die Angehörigen fühlen sich unterstützt. Stille ist meist eher beklemmend. Musik ist da offener. Es geht einem immer näher, wenn jemand spricht, oder spielt, der den Verstorbenen persönlich gekannt hat.
Magst du vielleicht noch eine persönliche Erfahrung teilen, eine Beerdigung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja klar, in München haben wir eine Beerdigung umrahmt aber leider auf dem falschen Friedhof, wir waren zur richtigen Zeit am falschen Ort. Des einen Freud des anderen Leid – wir haben keine Gage bekommen.




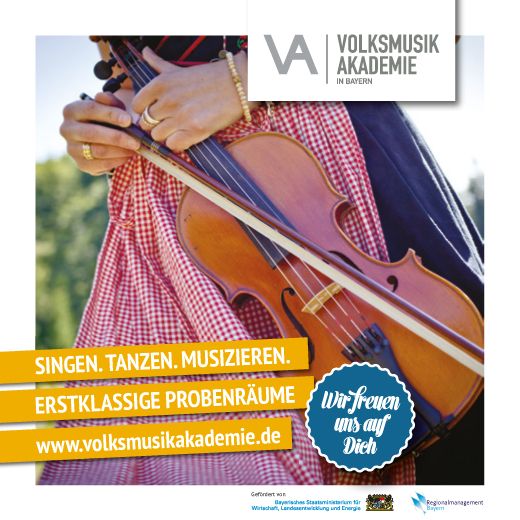


0 Kommentare