Text: Wulf Wager und Christof Heppeler Fotos: Stadtkapelle Mühlheim, Historisches Museum der Pfalz Speyer, Winckelmann- Museum Stendal
Aus gutem Grund hat der Tübinger Professor Ernst Meier 1851 seine Sammlung »Schwäbischer Volkslieder« mit einer Menge von über 400 Vierzeilern oder auch Schelmeliedle eröffnet. Dieses Wort charakterisiert die Vierzeiler recht gut. Es sind in Reimform gebrachte Neckereien, Keckheiten, Frechheiten und Unverschämtheiten, je nach der Betrachtung des Zuhörers oder des Sängers. Schnitz (von Aufschneiden, Übertreiben) nennt man diese kurzen Neckverse in Suppingen auf der Blaubeurer Alb, Rappeditzle in Schömberg im Kreis Rottweil und im Oberland verwendet man das bajuwarische Wort Schnaderhüpfel, das bereits der Wiener Hofprediger Abraham a Sancta Clara (1644–1709) für die Saugsangl benützte.
Im Wirtshaus und auf dem Tanzboden waren und sind noch diese kurzen Liedchen zuhause. In Suppingen dienen sie auch als sogenannte Anbinder, die oftmals an sentimentale Lieder oder Jägerlieder angehängt werden. Man neckt sich gegenseitig. Die Männer die Frauen, die Frauen die Männer, die Handwerker die Bauern, die Bauern die Schäfer, und die vom einen Ort necken die vom anderen. Keine andere Liedform lässt der Spontaneität mehr Raum als der Vierzeiler. Überlieferte Texte können zurechtgemacht, situationsbedingt angepasst werden. Schnell ist aber auch eine neue Strophe auf eine aktuelle Situation oder Bezug nehmend auf eine zufällig anwesende Person neu gedichtet und vorgetragen.

Historische Postkarte aus Mühlheim an der Donau
Schnitz und Rappeditzle
Der Vierzeiler dient nicht dem kollektiven Gesang, dazu taugt allenfalls der Anhang in Form eines Jodlers. Der Vierzeiler taugt zu Exposition einzelner in einem bierseligen Rahmen. Das Singen von Schnitz und Rappeditzle darf man nicht losgelöst sehen von der Stimmung, in der sie eine Eigendynamik bekommen.
Ernst Meier bringt es im Vorwort zu seiner schwäbischen Liedersammlung auf den Punkt: »Dabei sei hier nur kurz eines ziemlich verbreiteten Irrthums gedacht, als ob diese Lieder jemals von der Gesammtheit des Volkes gedichtet worden seien. Es gilt dieß von allen Volks- und Naturpoesien so gut wie von jeder Kunstdichtung. Das kleinste wie das größte Lied ist immer das Produkt einer einzelnen, poetisch begabten Person. Der wahre Volksdichter gehört aber seiner ganzen Bildungs- und Anschauungsweise nach dem Volke an; er singt und sagt nur das, was die Gesammtheit leicht erfasst und was ihr gefällt; was ihr nicht gefällt und keinen Beifall findet, darf der Sänger nicht wieder singen; es verhallt und findet keinen Boden. Trifft er aber glücklich den Ton und die Stimmung, in der die Gesamtheit fühlt, so bewahren tausend Herzen seine Worte und singen sie nach«. Als Beispiel führen wir hier »Mädle hüt de« aus der Sammlung Suppinger Lieder an. Es ist eigentlich ein Anbinder, also kein eigenständiges Lied. Strophen können beliebig hinzugefügt werden.
Untersucht man die Vierzeiler unter soziologischen Gesichtspunkten, so bilden sie ein Spiegelbild der sozialen Kontrolle in der lokalen bäuerlichen Gesellschaft. »Benützt man das Schnaderhüpfel als Grundlage zu einer Milieuanalyse, dann erscheint der Vierzeiler bis zu einem gewissen Grad als Antwort auch auf akute Nöte und Verhältnisse. […] Es ist ein Spiegelbild von individueller Neigung und kollektiver Mentalität, ein ›Denkrahmen‹, in dem sich Einzelner und Gruppe gleichermaßen angesprochen und verstanden fühlen.«
Der Vierzeiler ist ein meist achttaktiges einfaches Melodiegebilde basierend auf gebrochenen Dreiklängen der Grundstufe und der Dominante, dem vielfach ein Nachsatz (»holaria dio …«) angehängt ist.
Am intensivsten verschmelzen Form und Situation in den Lumpeliedle oder Rappeditzle. Sie sind, so der Tübinger Kulturwissenschaftler Hermann Bausinger, »von aller falschen Sentimentalität frei« und wurden von den Sammlern oft wenig beachtet, unter anderem deshalb, »weil sie in sich selbst, losgelöst von der besonderen Singgelegenheit, keinen Wert zu haben schienen.« Bekanntlich besteht eine Rappeditzlestrophe nur aus vier Zeilen. Ihren Reiz zieht sie aus dem Spiel mit dieser Kleinstform. Da die einzelnen Strophen innerlich nicht zusammenhängen, kann beim Singen jeder, wie›s ihm gerade einfällt, ein Versle einwerfen.
»Was für ein faszinierender Abend voller Witz und Esprit.«
A Pfingschta goht’s am ringschta!
Offenbar wurde uns dies unter anderem bei einer Feldforschung 1997 in Mühlheim an der Donau. Wir wussten, dass es einige weniger bekannte Lieder in einer jeweils speziellen Mühlheimer Form gab. Deshalb haben wir Sänger am Pfingstfreitag zu einem Wirtshausabend eingeladen und das Ganze ohne Struktur mit aufgebauten Mikrofonen laufen lassen. Nach einer kurzen Erklärung über unser Vorhaben begannen die acht Männer zu singen. Was für ein faszinierender Abend voller Witz und Esprit. Ein ganzes lokal geprägtes Liederbüchle mit 30 Wirtshausliedern, Schnitz und Rappeditzle ist daraus entstanden. Unzensiert und ungekürzt. Viele davon sind derb und vulgär, ja, sogar ordinär, wenn man sie außerhalb des Wirtshauses und außerhalb der Stimmung singt, in der sie ausschließlich zu Hause sind. Aber jeder kennt Beispiele aus der Schmuddelkiste der Volksseele und kann sie nach zwei, drei Gläsern Wein oder Bier selbst mitsingen oder zum Besten geben. Die Sammler-Vorgängergeneration hat diese Lieder fein säuberlich ad acta gelegt. Oder wenigstens die Schmuddelverse eliminiert. Das halten wir für unzulässig.
Nur ein Beispiel: Ganz im Sinne der freien Strophenfindung oder -bildung hat die Mühlheimer Version der bekannten Belagerung von Munderkingen ihr eigentliches Thema, bis auf die ersten beiden Reststrophen, völlig vergessen und verlegt sich lieber aufs freie Variieren. Solche Lieder kann man nicht vorsingen, nicht aufführen, sie müssen sich ereignen. Dann entstehen Strophen, wie jene vom Sunnefranz vum Lippachtal, die einer der Gewährsleute ad hoc zurechtschnitt, als eben dieser Sunnefranz, ein Jagdkollege des Sängers, den Kopf zur Tür hereinstreckte. Da nimmt es auch nicht Wunder, wenn die ab und an aufzüngelnden Diskussionen um korrekte Textfassungen immer wieder einstimmig beendet wurden, mit dem Hinweis »Descht doch egal!« Einer warf einmal, dies zuspitzend, ein: »Etzt mond’r eich go entscheida, suscht kummed d’ri d’ Nacht nei!« Egal heißt in diesem Fall nicht grundsätzlich gleichgültig, sondern für diese Art des Singens unbedeutend; ja, es ist für die Vierzeiler und die Gattung Wirtshauslieder im Ganzen wesentlich, in einem Spektrum zwischen Hörfehler und Zurechtsingen beweglich zu bleiben. Das gilt für den Text ebenso wie für die Melodie. So fördert der Vergleich mit dem Notentext, wo überhaupt möglich einen geringen Respekt zu Tage, den die Wirtshausversion der gedruckten Fassung entgegenbringt.
Niemals können Noten all das Angesprochene einfangen. Ist ein Lied erst einmal in Noten gefasst, so ist ihm nicht mehr anzusehen, dass es nicht Vorschrift sein will, sondern einen mühsam erarbeiteten, oft mit zwei oder drei Varianten (bei acht Sängern leicht möglich) kämpfenden Annäherungswert darstellt. Eigentlich müsste über jedem Lied der Ausspruch prangen, der kam, nachdem das erste Lied auf Tonband gesungen war: »So u’gfähr!«
Es ist also immer zu bedenken, dass das Lied nicht in der Einzahl, sondern nur im Gesamtbild seiner Varianten existiert. Jede Variante hat ihre eigene, kleine Geschichte dort, wo sie gesungen wird. Hier gibt es sie nur so, aber so gibt es sie auch nur hier. Sie ist Teil der Geschichte vor Ort. Und auch hier existiert die Variante nur als unwiederholbares Ereignis, kaum anders gespeichert als im Gedächtnis.
Für die beiden Sammler war der Abend mit den Mühlheimer Sängern eine gesunde Lektion. Wirtshauslieder, Schnitz und Rappeditzle muss man nicht nur hören, man kann sie nur erleben. Wer über Lieder redet, muss über ihr Umfeld reden. Wer Lieder sammelt, muss Situationen des Singens sammeln. Zwar meinten die Sänger: »A Pfingschta goht’s am ringschta!« Dass sich die richtige Wirtshausstimmung eingestellt hat, war trotzdem ein großes Glück für jene hinter den Mikrofonen. Kompliment an die davor!

Siehe auch: »Da Alois«
Aufmacher:
Literaturhinweise:
- Wulf Wager und Christof Heppeler, Vergesset auch das Trinken nicht, Tuttlingen 1997.
- Ernst Meier, Schwäbische Volkslieder, Berlin 1855, S. IV.
- Otto Holzapfel, Lexikon folkloristrischer Begriffe und Theorien (Volksliedforschung), Bern 1996 S. 291.Hermann Bausinger, Formen der »Volkspoesie« (= Grundlagen der Germanistik, 6), 2., verbesserte und vermehrte Auflage, Berlin 1980.
- Hermann Bausinger, Volkskultur in der technischen Welt, zuerst erschienen Stuttgart 1961, wiederveröffentlicht in der Reihe Campus, Bd. 1008, Frankfurt/Main 1986.
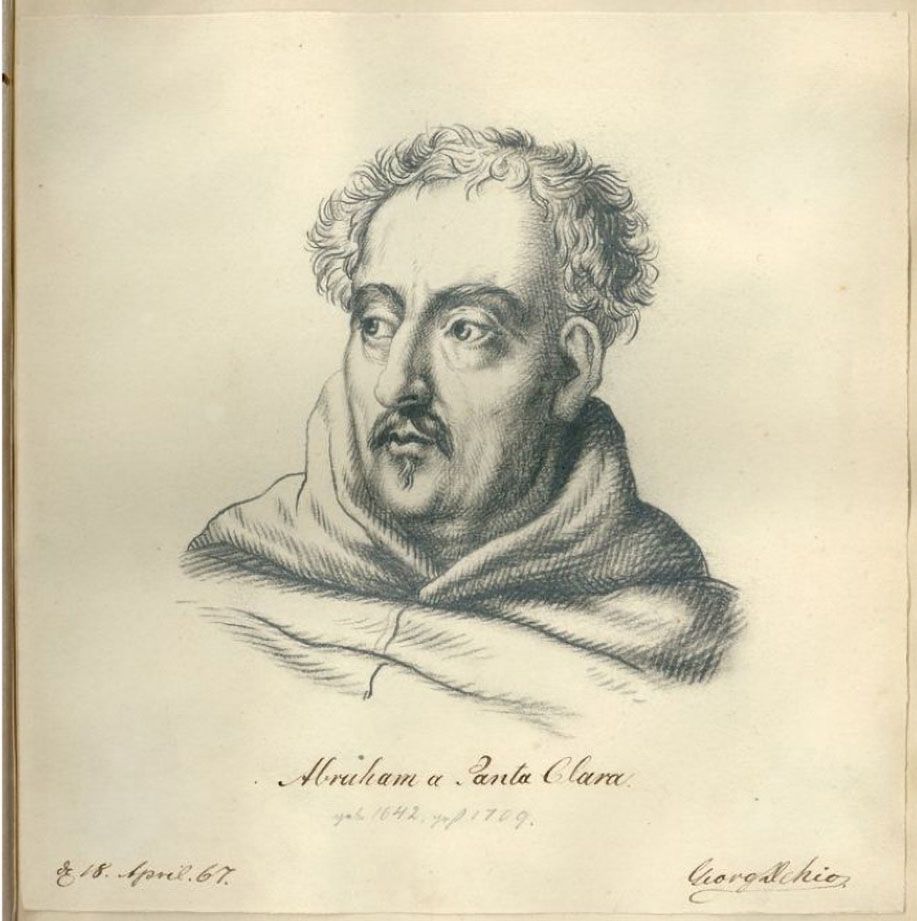
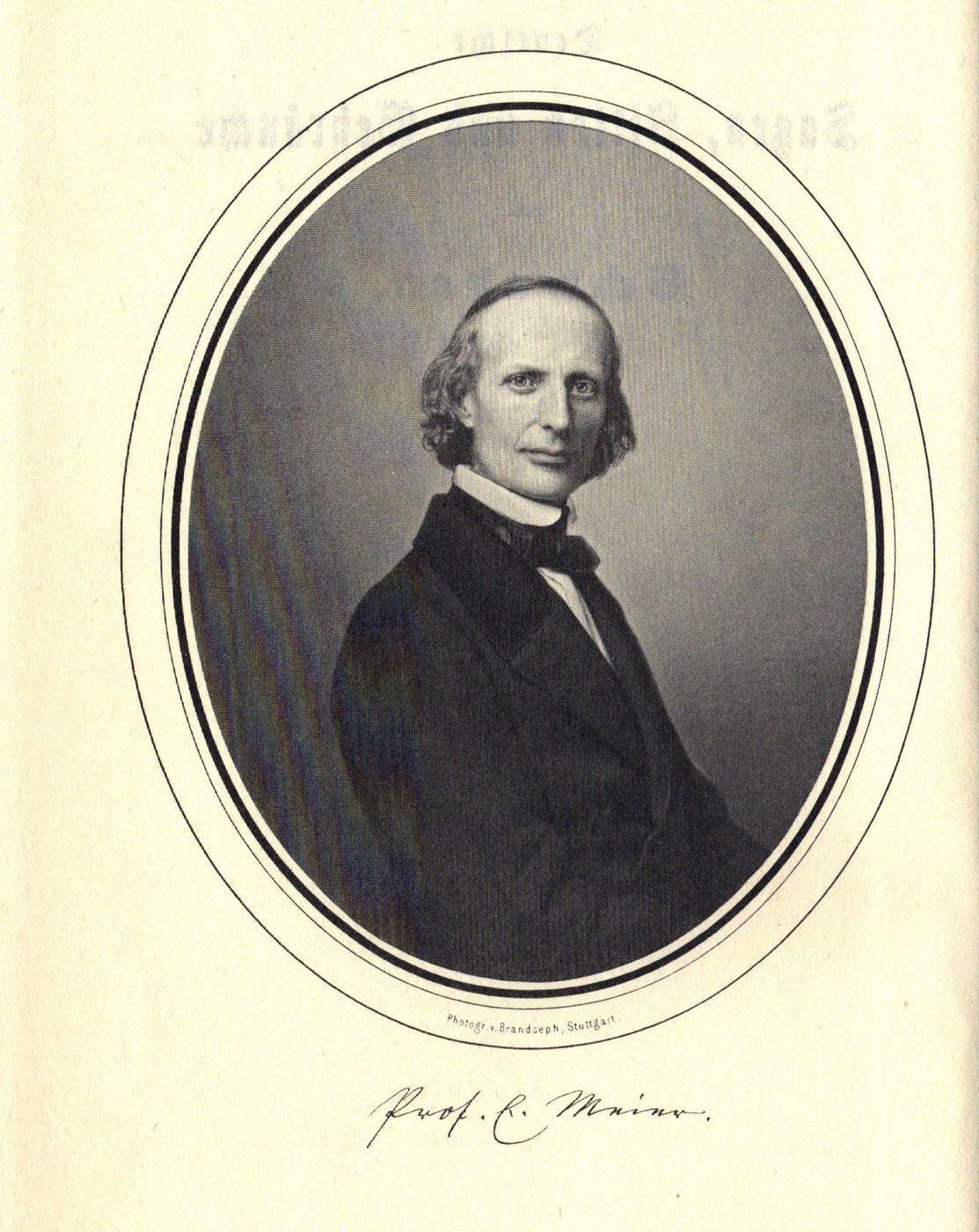


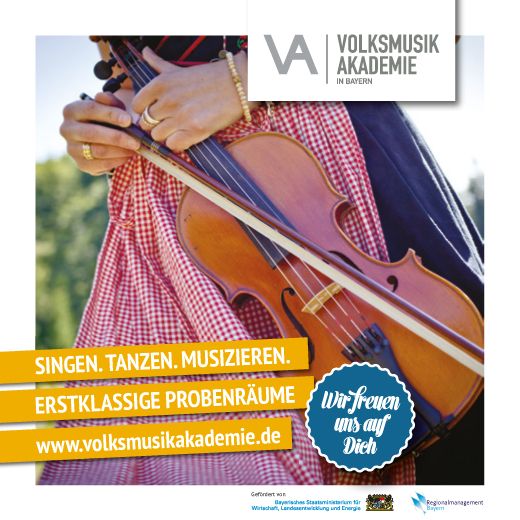


0 Kommentare