Text: Judith Jambor Fotos: Judtih Jambor, Andy84, Mathis, R. Fritz, privat
Tirol, das Land im Gebirge – dies wird in vielen Liedern besungen, viele Musikstücke sind einem Berg gewidmet und Musikgruppen haben sich nach einem Berg benannt, zu dem sie einen besonderen Bezug haben. Im folgenden Beitrag soll nun näher auf die Bedeutung einiger Bergnamen, über die gesungen und gespielt wird, eingegangen werden.
Silberspitze
Die Silberspitze (die Einheimischen sagen der Silberspitz) ist der Hausberg der Gegend von Zams und Schönwies. Er ist ein wunderschöner, markant in die Höhe ragender Gipfel, der der Bezeichnung Spitze alle Ehren macht, und ist deshalb auch ein äußerst beliebtes Fotomotiv für Menschen, die am Weitwanderweg E5 wandern. Auch in die Musik hat er Eingang gefunden, Gustl Retschitzegger hat ihm mit dem Stückl Hoch vom Silberspitz ein musikalisches Denkmal gesetzt. Der Name Silberspitze ist auf den Bergbau zurückzuführen. Ob hier aber tatsächlich Silber gefunden wurde oder nur silberfarbene Mineralien wie z. B. Bleiglanz, weiß man nicht. Der Name ist schon sehr alt, bereits im Jagdbuch von Kaiser Maximilian I., das aus dem Jahr 1500 n. Chr. stammt, wird von der »Jagd Am Silber« geschrieben. Hier würde es viele Hirsche geben, und »das ist ein guts/lustigs hirschgjaid« (= das ist ein gutes, lustiges Jagdgebiet für Hirsche).
Patscherkofel
Ein anderer Hausberg wird im Patscherkofel Landler von Peter Moser verewigt. Der Patscherkofel ist der Hausberg der Innsbrucker, dorthin geht man im Winter Schifahren, die Tourismuswerbung wirbt mit Fahrten mit der Gondelbahn auf den Innsbrucker Hausberg, mit Wandern am Hausberg. Dabei sagt sein Name etwas ganz anderes aus – der Patscherkofel ist nicht der Hausberg der Innsbrucker, sondern er war ursprünglich der Hausberg der Einwohner von Patsch. Sie hatten dort an seinen Westhängen ausgedehnten Gemeindebesitz und ihre Alm, die Patscher Alm, die schon im Atlas Tyrolensis von Peter Anich und Blasius Hueber eingezeichnet ist. Interessant ist, dass Kaiser Maximilian I. nicht am Patscherkofel, sondern am »Batscherkogl« jagen ging.
Tatsächlich muss der Berg früher einmal die Bezeichnung Kogel gehabt haben. So manch einer kann sich noch an den mundartlichen Ausdruck ’s Patschergigele erinnern, was so viel wie das Patscherkögele heißt. Warum dieser Berg Kofel genannt wird, ist eher rätselhaft, weil diese Bezeichnung in Nordtirol sonst praktisch nicht vorkommt. Es gibt nur noch fünf weitere Berge in Nordtirol, die Kofel heißen, die alle in den Zillertaler Alpen zu finden sind. Vier von ihnen liegen direkt an der Grenze zu Südtirol, nur einer, der Rossgrubenkofel, liegt etwas nördlich davon. Aber auch dieser wurde noch in einer Landkarte, die zwischen 1801 und 1805 gezeichnet wurde, als »Roßgraben Kogel« bezeichnet. In Süd- und Osttirol allerdings kennt man viele Kofel. Wie und warum es zum Wechsel von Kogel zu Kofel kam, weiß man nicht. 100 Jahre nach Maximilian I. ist in einer Landkarte schon der »Patscher Kofel M.« (M. steht für lat. Mons = Berg) zu lesen.
Kitzbüheler Horn
Auch Kitzbühel hat seinen Hausberg, das Kitzbüheler Horn. Nach diesem berühmten Berg hat sich der Kitzbühler Horn G’sang benannt. Das ist ein Quartett aus zwei Frauen und zwei Männern, das die Nachfolge der Gruppe Rund um ’s Horn Gsang angetreten hat. Ein Horn ist ein Berg mit einem spitzen Gipfel, der wie ein Horn einer Kuh oder eines Stiers, eines Ochsen aussieht. Im Bezirk Kitzbühel gibt es recht viele Hörner, besonders an der Grenze zu Salzburg. Auch in Osttirol kommen etliche vor, im Rest von Tirol sind es eher weniger. Dort, wo es viele Berge mit der Bezeichnung Horn gibt, kann es aber durchaus vorkommen, dass der Gipfel gar nicht so spitz, hornartig aufragt.
Da gibt es z. B. in den Allgäuer Alpen drei Hörner nebeneinander, das Gaishorn, das Rauhorn und das Kugelhorn. Während die ersten beiden von manchen Seiten wirklich mit einem Horn verglichen werden können, hat das Kugelhorn einen rundlichen Gipfel, der offensichtlich mit einer (Halb)kugel verglichen wurde. Horn wird in so einem Fall einfach in Anlehnung an die Namen der Umgebung verwendet. Wenn schon mehrere Hörner da sind, heißen auch andere Berge einfach so. Im Westen Tirols gibt es ein Gegenstück zum Ausdruck Horn: Muttler. Das ist eine Bezeichnung für einen hornlosen Widder, eine hornlose Geiß oder eine Kuh, die sich die Hörner abgestoßen hat. Sie wurde auf die Bergwelt übertragen und benennt hier rundliche Bergköpfe, wie z. B. Muttler, ein 2.553 m hoher Berg in der Gemeinde Nauders oder Muttlerkopf, 2.366 m, in der Gemeinde Holzgau. Der Ausdruck muttlet ist aus dem lateinischen Wort mutilus (= verstümmelt) entstanden.
Marienbergjodler
Der Marienbergjodler von Gustl Retschitzegger ist ein musikalischer Gruß an die Marienbergalm im Mieminger Gebirge. Hier gibt es eine nette Almhütte, die man auf einem steilen Alpsteig von Arzkasten am Holzleiten Sattel, Gemeinde Obsteig, erreichen kann. Wer es gemütlicher will, fährt von der anderen Seite von Biberwier mit der Marienbergbahn bis knapp unter den Marienbergsattel und wandert von dort über den Sattel zur Alm. Die Schirmherrin dieser Alm ist die Heilige Maria. Ihr zu Ehren ist hier eine große Marienstatue nach den Plänen von Architekt Markus Illmer weithin sichtbar aufgestellt. Die Alm ist schon sehr alt und muss auch wichtig gewesen sein, weil sie in etlichen Urkunden erwähnt wird. Die älteste stammt aus dem Jahre 1424, hier wird sie »sand Marienperg« genannt. Heute weiden in diesem Gebiet im Sommer bis zu 200 Kühe und Kälber.
Tschirgant.
Wer von Landeck in Richtung Osten fährt, dem fällt ein wunderschöner Berg auf, der wie eine Pyramide bei Imst in den Himmel ragt, der Tschirgant. Dieser mächtige Berg hat so manchen Musiker inspiriert, so auch Gustl Retschitzegger, der der Komponist der Tschirgant Polka ist. Der Name Tschirgant stammt aus längst vergangenen Zeiten. Das Wort, mit dem der Name gebildet wurde, wird heutzutage nicht mehr verstanden. Es gibt aber im Bergbau einen Fachausdruck, der etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Das Wort schürgen bedeutet hier labiles Gestein fortschieben. Im Mittelhochdeutschen war das Wort aber noch allgemein verständlich, schürgen (oder schurgen) wurde im Sinn von schieben, stoßen, treiben verwendet. Wenn man nun den Tschirgant betrachtet, so fallen die vielen Gesteinsmassen auf, die ständig an seiner Südseite ins Tal rutschen. Dies könnte zum Namen geführt haben: der Tschirgant ist der schürgende Berg, der Berg, der ständig Gestein herabschiebt. Diese Namensdeutung wird durch alte Urkunden und Schriftstücke untermauert, im Jahre 1459 wird über einen Berg »Schurgant« geschrieben, Kaiser Maximilian I. ging im Jahre 1500 am »Schirgan« auf die Jagd.






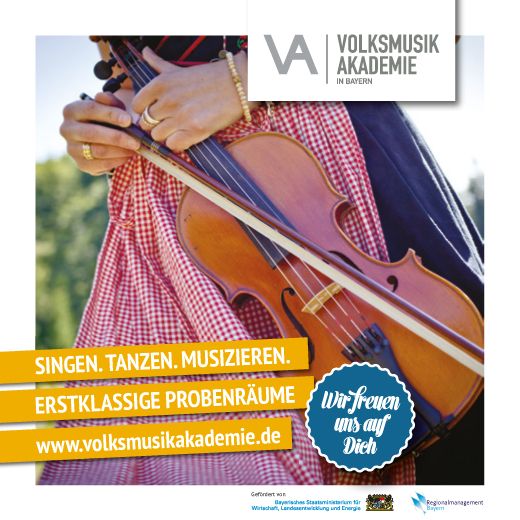


0 Kommentare